Umbau kann trotz möglicher Zweckentfremdung zulässig sein
Haufe Online Redaktion • 19. November 2025
Wird einem Wohnungseigentümer eine bauliche Veränderung gestattet, die ermöglicht, Räume entgegen ihrer Zweckbestimmung zu nutzen, führt dies nicht zur Anfechtbarkeit des Gestattungsbeschlusses, wenn auch eine zulässige Nutzung weiterhin möglich ist.
Hintergrund: Eigentümer bauen Kellerräume aus
In einer aus drei Einheiten bestehenden Wohnungseigentumsanlage hatten die Eigentümer zweier Einheiten in Räumen, die in der Teilungserklärung als "Kellerraum" bezeichnet sind, bauliche Maßnahmen vorgenommen. An den Räumen sind zu ihren Gunsten Sondernutzungsrechte bestellt.
In einem Raum hatten die Eigentümer eine Toilette eingebaut, in einem anderen Raum drei Heizkörper sowie eine geflieste Nasszelle mit Dusche, WC, Wasch- und Spülbecken. Außerdem hatten sie an der Fassade ein Leerrohr für ein TV-Kabel angebracht. In einer Eigentümerversammlung wurden die Einbauten per Mehrheitsbeschluss nachträglich genehmigt.
Der Eigentümer der dritten Einheit hat gegen diese Beschlüsse Anfechtungsklage erhoben. Er meint, die Maßnahmen seien mit der Zweckbestimmung der Räume als "Kellerräume" unvereinbart und daher rechtswidrig.
Entscheidung: Auf die Nutzung kommt es an
Die Anfechtungsklage hat keinen Erfolg. Die Beschlüsse sind nicht zu beanstanden.
Bei den genehmigten Maßnahmen handelt es sich um bauliche Veränderungen des Gemeinschaftseigentums, die durch einen Beschluss nach § 20 Abs. 1 WEG nachträglich gestattet werden sollten. In welchem Verhältnis eine solche Gestattung zu einer Nutzungsvereinbarung in der Teilungserklärung steht, ist bislang ungeklärt.
Allerdings hat der BGH bereits entschieden, dass ein Beschluss über die Gestattung einer baulichen Veränderung selbst dann bestandskräftig werden kann, wenn die vereinbarte Nutzung durch den Umbau faktisch nicht mehr möglich ist. Wann ein solcher Beschluss anfechtbar ist, ließ der BGH bisher offen und musste es auch hier nicht entscheiden, weil die vereinbarte Nutzung trotz der Umbauten möglich blieb.
Wird einem Wohnungseigentümer eine bauliche Veränderung gestattet, die eine Nutzung entgegen einer vereinbarten Zweckbestimmung ermöglicht, führt dies jedenfalls dann nicht zur Anfechtbarkeit des Gestattungsbeschlusses, wenn auch eine nach der Vereinbarung zulässige Nutzung weiterhin möglich ist. So lag der Fall hier.
Zwar dienen Räume, die als "Keller" oder "Kellerräume" bezeichnet werden, nur untergeordneten Zwecken und dürfen nicht zu Wohnzwecken genutzt werden. Gleichwohl sind die Beschlüsse aber nicht schon deshalb zu beanstanden, weil die gestatteten Maßnahmen (auch) eine Wohnnutzung der Kellerräume ermöglichen könnten. Denn trotz der Umbauten sind die Räume weiterhin so nutzbar, wie es die Zweckbestimmung als Kellerraum erlaubt, etwa als Fitness- oder Fernsehraum.
Befindet sich beispielsweise in einem Hobbyraum ein Fitnessgerät, wird der Raum nicht deshalb zu einer Wohnung, weil sich in oder neben dem Raum eine Dusche befindet. Das Gleiche gilt, wenn ein Raum zum Fernsehen genutzt und beheizt werden kann. Die Nutzung der solchermaßen ausgestatteten Räume in einem zulässigen untergeordneten Rahmen bleibt möglich.
Unterlassungsansprüche bei störender Nutzung
Dass die baulichen Maßnahmen eine zweckbestimmungswidrige Wohnnutzung ermöglichen und deren Vorbereitung dienen könnten, führt zu keiner anderen Beurteilung. Kommt es tatsächlich zu einer Wohnnutzung, kann die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (GdWE) Unterlassung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 WEG bzw. § 1004 Abs. 1 BGB verlangen. Ebenso kann sie gegen einzelne störende Handlungsweisen bei der zulässigen Nutzung als Hobbyraum vorgehen, etwa bei Lärmbelästigung.
Letztlich ist zwischen der Zulässigkeit der baulichen Maßnahme einerseits und der späteren Nutzung anderseits zu differenzieren.
(BGH, Urteil v. 10.10.2025, V ZR 192/24)
Lesen Sie auch:
BGH-Rechtsprechungsübersicht zum Wohnungseigentumsrecht

Der Arbeitgeber zieht bei der Entgeltabrechnung Steuern und Sozialversicherungsbeiträge vom Gehalt der Mitarbeitenden ab und leitet diese an das Finanzamt sowie die Krankenkasse weiter. Ist eine nachträgliche Korrektur notwendig, sind unterschiedliche Regelungen zu berücksichtigen. Bei der Entgeltabrechnung werden die Lohnsteuer und von den Arbeitnehmenden zu tragende Anteile am Sozialversicherungsbeitrag vom Arbeitsentgelt einbehalten. Der Arbeitgeber führt die einbehaltene Steuer an das Finanzamt ab. Die Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile) zahlt der Arbeitgeber an die zuständige Krankenkasse. Steuer: Berichtigung nach Ausstellung der Lohnsteuerbescheinigung unzulässig Der Arbeitgeber muss die elektronische Lohnsteuerbescheinigung bei Beendigung des Dienstverhältnisses oder nach Ablauf des Kalenderjahres an das Finanzamt übermitteln. Sie muss spätestens bis zum letzten Tag im Februar des folgenden Jahres übermittelt sein, für 2025 also bis zum 28. Februar 2026. Der Arbeitgeber ist berechtigt, bei der jeweils nächstfolgenden Lohnzahlung bisher noch nicht erhobene Lohnsteuer nachträglich einzubehalten. Nach Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung ist eine Korrektur des Lohnsteuerabzugs durch den Arbeitgeber grundsätzlich nicht mehr möglich. Ausnahme: Korrektur fehlerhafter Datensätze Die Verwaltung zeigt sich in ihrem Erlass zum Ausfüllen der Lohnsteuerbescheinigungen ab 2025 (BMF-Schreiben vom 5. September 2024 – IV C 5 - S 2378/19/100002 :002) bezüglich nachträglicher Korrekturen etwas großzügiger als bisher: Es wird nicht beanstandet, wenn eine Korrektur einer bereits übermittelten elektronischen Lohnsteuerbescheinigung noch bis zum letzten Tag des Monats Februar des Folgejahres ohne Vorliegen eines gesetzlichen Änderungsgrundes vorgenommen wird. Beispielsweise könnte eine bereits im Januar übermittelte Bescheinigung noch bis Ende Februar des jeweiligen Jahres berichtigt werden. Eine (spätere) Korrektur oder Stornierung kommt darüber hinaus in Betracht, wenn es sich um die bloße Berichtigung eines zunächst unrichtig übermittelten Datensatzes handelt. Korrigierte Lohnsteuerbescheinigungen sind mit dem Merker "Korrektur" zu versehen. Keine Korrekturmöglichkeit: Haftungsbefreiende Anzeige beim Finanzamt einreichen Der Arbeitgeber muss verbleibende Fälle, in denen er die Lohnsteuer nicht nachträglich einbehalten kann, unverzüglich dem Betriebsstättenfinanzamt anzeigen (sogenannte haftungsbefreiende Anzeige im Sinne des § 41c Absatz 4 EStG), damit das Finanzamt die zu wenig erhobene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin nachfordern kann. Wurde zu viel Lohnsteuer einbehalten, kann sich der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin diese im Rahmen einer Einkommensteuerveranlagung "zurückholen". SV: Berichtigungen beim Arbeitnehmer nur drei Monate zulässig Der Arbeitgeber ist ebenfalls verpflichtet, die fehlenden Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile) nachzuentrichten. Dabei darf ein unterbliebener Beitragsabzug der Arbeitnehmeranteile nur bei den drei nächsten Entgeltabrechnungen nachgeholt werden. Korrektur der Entgeltabrechnung: Lohnsteuer und Sozialversicherung Beispiel: Ein Firmen-PKW, den ein Arbeitnehmer auch für private Fahrten nutzen darf, wird bei der Entgeltabrechnung mit 400 Euro monatlich berücksichtigt. Bei einer internen Überprüfung vor der Entgeltabrechnung Mai 2026 wird festgestellt, dass wegen eines Fahrzeugwechsels für diesen Arbeitnehmer seit Juli 2025 monatlich 500 Euro als geldwerter Vorteil maßgebend sind. Ergebnis: Lohnsteuerlich müssen die Entgeltabrechnungen ab Januar 2026 berichtigt werden und der Arbeitgeber kann die daraus resultierende höhere Lohnsteuer vom Arbeitslohn des Arbeitnehmers einbehalten. Die für 2025 bereits an das Finanzamt übermittelte Lohnsteuerbescheinigung ist ausschließlich hinsichtlich der steuerpflichtigen Einkünfte des Arbeitnehmers zu berichtigen und dem Finanzamt erneut zu übermitteln. Der Lohnsteuerabzug darf nicht korrigiert werden. Anstelle des Lohnsteuerabzugs zeigt der Arbeitgeber den unterbliebenen Lohnsteuerabzug für 2025 dem Finanzamt mit einer haftungsbefreienden Anzeige an. Die Abführung der Sozialversicherungsbeiträge ist ab Juli 2025 zu berichtigen. Dabei darf der Arbeitgeber bei der Entgeltabrechnung für Mai 2026 nur noch den unterbliebenen Beitragsabzug für die Monate April, März und Februar 2026 nachholen. Für die Monate davor übernimmt der Arbeitgeber auch die Arbeitnehmeranteile an den Sozialversicherungsbeiträgen.

Die vom Bundesministerium des Innern und Heimat (BMI) veröffentlichte Matchingplattform für den KI-Einsatz in der Bundesverwaltung heißt „Marktplatz der KI-Möglichkeiten“ (MaKI). Zunächst sollen Ministerien und Behörden miteinander vernetzt werden, später auch diese enger mit Wirtschaft, Forschung und Bürgern. Der neue „ Marktplatz der KI-Möglichkeiten“ (MaKI) ist eine zentrale Initiative des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI). Ziel ist es, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der öffentlichen Verwaltung besser zu strukturieren und zu fördern. Die Plattform richtet sich zunächst an Ministerien und Bundesbehörden. Perspektivisch soll der Marktplatz um neue Funktionalitäten erweitert und für alle anderen öffentlichen Verwaltungen sowie für Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft geöffnet werden. Entstehungshintergrund Der MaKI wurde in enger Zusammenarbeit zwischen dem Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS), dem IT-Planungsrat und dem Deutschen Landkreistag entwickelt und umgesetzt. Begleitet wurde das Projekt von den Pilot- bzw. Testländern Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg. Durch diese breite Kooperation soll sichergestellt werden, dass die Plattform die Bedürfnisse aller Verwaltungsebenen abbildet – von der obersten Bundesbehörde bis zur Kommune. Das Projekt wird von der Projektgruppe Künstliche Intelligenz (PG KI) im Rahmen des Beratungszentrums für Künstliche Intelligenz (BeKI) verwaltet. Bausteine und Ziele Die wesentlichen Bausteine und Ziele des Marktplatzes sind: Vernetzung und Matching: Der Marktplatz dient als Matchingplattform, um Akteure mit ähnlichen Bedarfen zusammenzubringen und den Wissensaustausch zwischen Behörden zu erleichtern. Zentrales Transparenzregister: Das Register soll eine Übersicht über bereits existierende, in Planung oder in Entwicklung befindliche KI-Systeme und -projekte innerhalb der Bundesverwaltung geben. Förderung der Nachnutzung: Behörden können über die Plattform auf bereits entwickelte Lösungen anderer Dienststellen zurückgreifen („Einer-für-Alle“-Prinzip), um Doppelentwicklungen zu vermeiden und somit Ressourcen zu sparen. Skalierung auf Kommunen und Länder: Langfristig soll die Plattform über die Bundesverwaltung hinaus auch Ländern und Kommunen zur Verfügung stehen. Strukturierte Erfassung: Durch ein Dashboard werden KI-Anwendungen nach Themen, Branchen und Leistungen kategorisiert, was die Auffindbarkeit spezifischer Lösungen verbessern soll. Die Plattform ist bewusst niedrigschwellig gestaltet. So können Bund, Länder und Kommunen KI-Systeme einstellen und Kooperationen anstoßen. Wirtschaft und Wissenschaft erhalten einen transparenten Einblick in den Einsatz von KI in der Verwaltung. Bürger profitieren von besseren Services, effizienteren Abläufen und moderner Kommunikation. Technische Details Laut dem an der technischen Entwicklung beteiligten IT-Dienstleister Materna erfolgt der Einstiegspunkt zur Plattform über eine Subsite im BMI-Mandanten, die mit der Content-Management-Lösung „Government Site Builder” realisiert wurde. Das entwickelte Formular-Management-System gewährleistet eine standardisierte und KI-VO-konforme Datenerfassung der KI-Systeme. Die strukturierten Daten dienen als Grundlage für das mit der Open-Source-Lösung Grafana erstellte Dashboard. Es bietet nicht nur Visualisierungen der gemeldeten KI-Systeme, sondern ermöglicht über das Transparenzregister auch detaillierte Einblicke in einzelne Projekte.

Eine Strahlenschutzbeauftragte hat sich erfolgreich gegen ihre Kündigung gewehrt, die aufgrund ihrer Ablehnung einer Gender-Weisung ausgesprochen wurde. Das Landesarbeitsgericht Hamburg erklärte die Kündigung für unwirksam. Dies geschah jedoch aus formellen Gründen. Gleichzeitig stellte das Gericht klar, dass Arbeitgeber das Gendern grundsätzlich anordnen dürfen. Die Klägerin ist seit 2012 als Diplom-Chemikerin im Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) tätig. Auf das Arbeitsverhältnis findet der TVöD Anwendung. Die Klägerin weigerte sich, eine Strahlenschutzanweisung vollständig gegendert zu verfassen. Daraufhin sprach der Arbeitgeber zunächst zwei Abmahnungen und schließlich eine außerordentliche Kündigung mit Auslauffrist aus. Hiergegen war die Strahlenschutzbeauftragte schon in erster Instanz erfolgreich vorgegangen. Abmahnungen und Kündigungen unwirksam Die Kündigung sowie die beiden vorangegangenen Abmahnungen waren jedoch aus formellen Gründen unwirksam. Die Klägerin war nicht dazu verpflichtet, Anpassungen in der Strahlenschutzanweisung auf Anordnung ihrer Führungskräfte vorzunehmen. Eine solche Verpflichtung folgte nicht aus dem Arbeitsvertrag in Verbindung mit der ihrem Arbeitsplatz zugrunde liegenden Stellendokumentation. Diese Verpflichtung hätte ihr der Strahlenschutzverantwortliche des Bundesamtes nach § 70 Abs. 2 Strahlenschutzgesetz i. V. m. § 43 Strahlenschutzverordnung übertragen werden müssen. Da dies nicht geschehen ist, durfte die Klägerin für die Weigerung, der Weisung Folge zu leisten, auch nicht von ihrem Arbeitgeber sanktioniert werden. Arbeitgeber dürfen Gender-Weisung erteilen Die Nichtbefolgung einer wirksamen Weisung kann eine arbeitsvertragliche Pflichtverletzung darstellen, die eine Abmahnung oder Kündigung rechtfertigt. Da die Gender-Weisung in diesem Fall jedoch nicht ordnungsgemäß übertragen wurde, war die Klägerin berechtigt, die Weisung zu verweigern, ohne dafür von ihrem Arbeitgeber sanktioniert zu werden. Die Kammer kam zu der Einschätzung, dass Arbeitgeber ihre Beschäftigten grundsätzlich durchaus anweisen können, in Dokumenten zu gendern.

Das FG Rheinland-Pfalz stellt klar, dass ein Geldgeschenk zu Ostern i. H. von 20.000 EUR kein steuerfreies "übliches Gelegenheitsgeschenk" ist und somit Schenkungssteuer anfällt. Worum ging es in dem Fall? Der Kläger erhielt von seinem im Jahr 2023 verstorbenen Vater seit März 2006 mehrfach Geldschenkungen zwischen 10.000 und 50.000 EUR, einmal sogar 100.000 EUR. Bis zur hier streitigen Schenkung zum Osterfest 2015 summierten sich die Zuwendungen bereits auf 450.000 Euro und überschritten damit den für den Kläger geltenden steuerlichen Freibetrag von 400.000 EUR innerhalb von zehn Jahren. Bis Juli 2017 stieg der Gesamtbetrag der Schenkungen auf 610.000 EUR. Schenkung zu Ostern Der Vater erzielte in den Jahren 2013 bis 2022 aus einer Beteiligung an einer GmbH & Co. KG jährliche Einkünfte zwischen rund 1,7 und 3,7 Millionen EUR. Sein Vermögen belief sich zum Zeitpunkt der Osterschenkung 2015 auf etwa 30 Millionen EUR. In seiner Erbschaftsteuererklärung gab der Kläger an, innerhalb des maßgeblichen Zehn-Jahres-Zeitraums acht Geldschenkungen erhalten zu haben, die als "übliche Gelegenheitsgeschenke" nach dem Erbschaftsteuergesetz steuerfrei seien – darunter auch die streitige Osterschenkung vom 31.3.2015 über 20.000 EUR. Festsetzung von Schenkungssteuer Das Finanzamt sah dies anders: Zwar falle keine Erbschaftsteuer an, wohl aber Schenkungsteuer. Diese wurde festgesetzt. Der Einspruch des Klägers blieb erfolglos, da ein Geldbetrag in dieser Höhe nicht mehr als übliches Ostergeschenk anzusehen sei. Auch die anschließend erhobene Klage hatte keinen Erfolg. FG Rheinland-Pfalz, Urteil v. 4.12.2025, 4 K 1564/24, veröffentlicht am 14.1.2026

Das neue Recht auf Reparatur soll für ausgewählte technische Geräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke und Smartphones gelten. Hersteller werden verpflichtet, diese Produkte über mehrere Jahre hinweg zu einem angemessenen Preis zu reparieren. Der Gesetzesentwurf soll der Förderung nachhaltigen Konsums und der Stärkung von Verbraucherrechten dienen. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen einen Anreiz erhalten, sich bei einem defekten Produkt für eine Reparatur zu entscheiden, wenn sie auch eine Neulieferung verlangen könnten. Ihr Recht auf Mangelgewährleistung soll sich bei einer Entscheidung für eine Reparatur von zwei auf drei Jahre verlängern. Nichtreparierbarkeit als Sachmangel Kann ein Produkt nicht reparieren, welches üblicherweise bei dieser Produktkategorie reparierbar ist, so gilt dies als Sachmangel. In diesem Fall können Käuferinnen und Käufer ihre Gewährleistungsrechte in Anspruch nehmen. Erweiterung Mangelbegriff des §434 BGB Dafür wird der Mangelbegriff in §434 Abs. 3 Satz 2 BGB wie folgt ergänzt: „Zu der üblichen Beschaffenheit nach Satz 1 Nummer 2 gehören Menge, Qualität und sonstige Merkmale der Sache, einschließlich ihrer Haltbarkeit, Reparierbarkeit, Funktionalität, Kompatibilität und Sicherheit.“ Ziel: Kreislauforientierte Ausrichtung der Wirtschaft Der Gesetzesentwurf basiert auf der EU-Richtlinie zum Recht auf Reparatur. Diese zielt neben der Verbesserung des Funktionierens des Binnenmarktes und der Sicherstellung eines hohen Verbraucherschutzniveaus auf eine kreislauforientierte Ausrichtung der Wirtschaft. Um die vorzeitige Entsorgung brauchbarer Waren, die von Verbrauchern gekauft wurden, zu verringern und die Verbraucher dazu anzuregen, ihre Waren länger zu nutzen, sollen die Bestimmungen über die Reparatur von Waren gestärkt werden. Bundesjustizministerin sieht Anreiz für Käufer pro Reparatur Bundesjustizministerin Dr. Stefanie Hubig erklärt dazu: "Hersteller sollen bei bestimmten Produktgruppen künftig verpflichtet sein, Reparaturen vorzunehmen und Ersatzteile vorrätig zu halten. Außerdem sollen Verbraucherinnen und Verbraucher einen konkreten Anreiz erhalten, sich für eine Reparatur zu entscheiden statt für die Lieferung eines neuen Produkts." Neues Recht auf Reparatur Verbraucher sollen die Möglichkeit haben, defekte Geräte über mehrere Jahre hinweg unentgeltlich oder zu einem angemessenen Preis vom Hersteller reparieren zu lassen. Für Waschmaschinen etwa soll dies ab Zeitpunkt der Herstellung für mindestens zehn Jahre, für Smartphones für mindestens sieben Jahre, möglich sein. Für Produkte, für die Hersteller bereits nach geltendem Recht Ersatzteile vorrätig halten müssen, müssen Hersteller in Zukunft auf die Reparatur ermöglichen. Relevanz nach Ablauf der Gewährleistungsfrist Auch wenn keine Mängelgewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer mehr bestehen, können sich die Käufer so noch an die Hersteller wenden. Das Recht auf Reparatur greift aber auch, wenn ein Produkt nicht schon bei Gefahrübergang mangelhaft war, sondern der Mangel erst später entstanden ist, oder wenn sich nicht beweisen lässt, dass der Mangel schon von Anfang an bestand. Zudem soll sich die Gewährleistungsfrist von 2 auf 3 Jahre verlängern, wenn sich Verbraucher bei einem mangelhaften Produkt dazu entscheiden, es reparieren zu lassen. Der Gesetzesentwurf wurde am 15.1.2026 veröffentlicht. Quelle: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
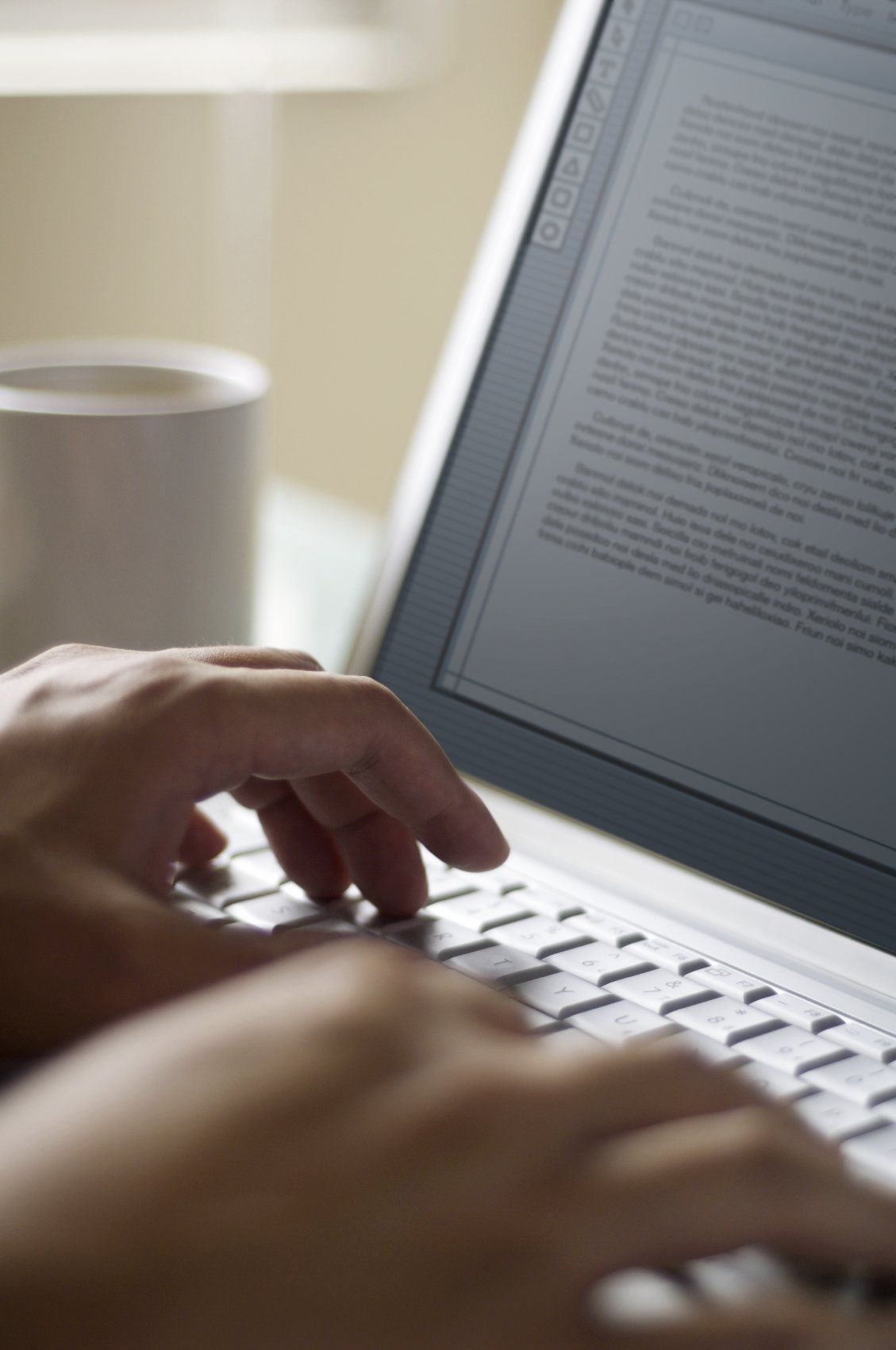
Wer ohne Einwilligung der User Cookies setzt, haftet auf Unterlassung und Schadenersatz. Dies gilt auch, wenn er selbst nicht der Betreiber der Website ist. Das OLG Frankfurt hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob auch derjenige, der keine eigenen Websites betreibt für rechtswidrig gesetzte Cookies in die Haftung genommen werden kann. Die Antwort des OLG ist eindeutig: Nicht nur die unmittelbaren Betreiber von Websites, sondern jeder, der – auch mittelbar über Websites anderer Betreiber – auf ein Endgerät zugreift, ist Haftungsadressat für Verstöße gegen das Telekommunikations-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz (TDDDG). Cookies grundsätzlich nur mit Einwilligung Gegenstand des vom OLG in zweiter Instanz entschiedenen Rechtsstreits war die Zulässigkeit der Speicherung und des Auslesens von mittels Cookies generierter Daten durch die Beklagte zu werblichen Zwecken auf dem Smartphone eines privaten Users ohne dessen Einwilligung. § 25 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 TDDDG verbietet es jedem Anbieter von elektronischen Informationen und Kommunikationsdiensten, Informationen auf der Endeinrichtung eines Endnutzers zu speichern oder auf diese Informationen zuzugreifen, wenn der Handy-Nutzer nicht auf der Grundlage einer klaren und umfassenden Information in diese Nutzung eingewilligt hat. Die Vorschrift dient dem Schutz der Privatsphäre des Nutzers und ist nach der Bewertung des OLG damit letztlich ein Ausfluss der Grundrechte auf informationelle Selbstbestimmung sowie auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Verbot ungenehmigten Zugriffs Das OLG stellte klar, dass § 25 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 TDDDG auch einen Unterlassungsanspruch nach bürgerlichem Recht nicht ausschließt. Die Vorschrift beschränke sich auch nicht auf „Anbieter“ im technischen Sinne. § 25 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 TDDDG untersage vielmehr jedermann den Zugriff auf vernetzte Endeinrichtungen ohne die Einwilligung des Endnutzers. Adressat des Gesetzes seien sowohl die Anbieter von Telemediendiensten als auch jegliche andere Zugriffsinteressierten. Im Ergebnis adressiere die Vorschrift jede natürliche oder juristische Person, die kausal die Ausführung oder den Zugriff auf eine Endeinrichtung veranlasst, und zwar unabhängig davon ob sie formal datenschutzrechtlich Verantwortlicher ist oder nicht. Cookies durch Privatgutachten hinreichend nachgewiesen Im konkreten Fall ging der Senat unter Bezugnahme auf ein vom Kläger vorgelegtes Privatgutachten davon aus, dass Cookies der Beklagten ohne Einwilligung des Klägers beim Besuch mehrerer Internetseiten auf dessen Endgerät gespeichert worden sind. Die Beklagte sei den Ausführungen in dem Gutachten nicht substantiiert entgegengetreten. Darüber hinaus habe die Beklagte nicht darlegen können, dass der Kläger in die Platzierung der Cookies eingewilligt habe. Die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen einer Einwilligung liege allein bei der Beklagten. Kein Rechtsmissbrauch des Klägers Entgegen der Auffassung der Beklagten war eine Einwilligung im entschiedenen Fall auch nicht konkludent anzunehmen. Diese Frage kam auf, weil der Kläger diverse Websites bewusst besucht hatte, um die Richtigkeit seiner Vermutung zu überprüfen, dass die Beklagte über diese Websites ungefragt Cookies setzt. Diese Vorgehensweise ist nach der Bewertung des OLG nicht zu beanstanden. Der Kläger habe - ähnlich einem Testkäufer von Produkten - bewusst die diversen Seiten zum Zweck der Überprüfung seines Verdachts besucht. Dies sei ein rechtlich zulässiges Vorgehen zum Zwecke der Dokumentation unberechtigter Zugriffe auf die Geräte von Endnutzern. Eine konkludente Einwilligung liege in diesem Vorgehen nicht. Beklagte haftet als Täterin Die Beklagte haftet nach Auffassung des Gerichts als Täterin. In Anlehnung an strafrechtliche Kategorien sei der Rechtsverstoß der Beklagten als mittelbarer Täterin zuzurechnen. Informationen in Form von Cookies seien auf den Endeinrichtungen der Nutzer auf Veranlassung der Beklagten gespeichert worden, sobald die entsprechende Anforderung auf der vom Nutzer besuchten Internetseite ausgelöst wurde. Unbestritten greife die Beklagte auf diese hinterlegten Informationen zu, indem sie sich diese von den Betreibern der Internetseiten überstellen lässt. Immaterieller Schaden ist gering Die Höhe des immateriellen Schadens des Klägers gemäß Art. 82 Abs. 1 DSGVO bewertete das OLG allerdings deutlich niedriger als die Vorinstanz. Das OLG reduzierte das von der Vorinstanz auf 1.500 Euro festgesetzte Schmerzensgeld auf 100 Euro. Dabei berücksichtigte der Senat, dass der Kläger die Rechtsverstöße bewusst in Kauf genommen hatte. Mehr als ein allgemeines Gefühl des Kontrollverlustes hinsichtlich der gespeicherten Daten sei als immaterielle Beeinträchtigung nicht erkennbar. Dieses Gefühl des Überwachtwerdens habe der Kläger beim Besuch der entsprechenden Websites bewusst in Kauf genommen. Durch Löschung der Cookies hätte er jede Nachverfolgbarkeit durch die Beklagte umgehend verhindern können. Ein Schmerzensgeld von 100 Euro sei daher tatangemessen und als Schadenskompensation ausreichend. (OLG Frankfurt, Urteil v. 11.12.2025, 6 U 81/23)

Das kostenlose oder verbilligte Aufladen von Elektro- bzw. Hybridelektrofahrzeugen im Betrieb des Arbeitgebers ist steuerfrei - ebenso wie der geldwerte Vorteil bei der Überlassung einer betrieblichen Ladevorrichtung. Schwieriger ist die Erstattung privat getragener Stromkosten. Die Verwaltung hat nun zu allen Fallgruppen einen überarbeiteten Erlass herausgegeben. Neu ab 2026 ist vor allem eine Strompreispauschale für das Aufladen des Dienstwagens zu Hause. Das kostenlose oder verbilligte Aufladen der Batterien von Elektro- bzw. Hybridelektrofahrzeugen im Betrieb des Arbeitgebers ist nach § 3 Nr. 46 EStG steuerfrei, wenn der Arbeitgeber die Leistung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt. Aufladen beim Arbeitgeber: steuerfreier Ladestrom für Elektro- bzw. Hybridfahrzeuge Der steuerfreie Ladestrom ist eine weitere Steuerförderung für Elektro- bzw. Hybridelektrofahrzeuge. Dabei kommt es nicht darauf an, ob es sich um ein Privat- oder Firmenfahrzeug handelt. Während bei der Ein-Prozent-Regelung der vom Arbeitgeber gestellte Ladestrom ohnehin durch den Ansatz des pauschalen Nutzungswerts abgegolten ist, werden Firmenwagen bei Anwendung der Fahrtenbuchmethode durch die Herausnahme der Stromkosten in die Begünstigung einbezogen. Im Mittelpunkt der Begünstigung steht aber das Aufladen privater Elektrofahrzeuge oder Hybridelektrofahrzeuge des Arbeitnehmers beim Arbeitgeber. Die Steuerbefreiung ist weder auf einen Höchstbetrag, noch auf die Anzahl der begünstigten Kraftfahrzeuge begrenzt. Begünstigt ist das Aufladen an jeder ortsfesten betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers oder eines mit dem Arbeitgeber verbundenen Unternehmens. Die Steuerbefreiung gilt übrigens auch für Leiharbeitnehmer im Betrieb des Entleihers. Die Steuerbefreiung gilt mindestens bis Ende 2030. Der betriebliche Ladestrom bleibt auch sozialversicherungsfrei. Die Verwaltung hat ein ergänztes und aktualisiertes Anwendungsschreiben herausgegeben ( BMF, Schreiben vom 11. November 2025, IV C 5 - S 2334/00087/014/013). Dessen Regelungen sind in allen offenen Fällen bis zum Auslaufen der Steuervergünstigungen anzuwenden. Eine Ausnahme bildet nur die erst ab 2026 gültige Strompreispauschale für das Aufladen des Dienstwagens zu Hause (lesen Sie dazu den Absatz "Privates Aufladen des Elektrodienstwagens: Abschaffung der Monatspauschalen – Vereinfachung beim Strompreis"). Strom aus Ladevorrichtungen Dritter nur unter weiteren Bedingungen steuerfrei Grundsätzlich nicht begünstigt ist der geldwerte Vorteil aus dem Aufladen bei einem Dritten oder an einer von einem fremden Dritten betriebenen Ladevorrichtung. Soweit der Arbeitgeber die Stromkosten für das Aufladen von Fahrzeugen der Beschäftigten jedoch unmittelbar trägt, ist der Vorteil aus dem unentgeltlich oder verbilligt bezogenen Ladestrom auch dann steuerfrei, wenn die genutzte Ladevorrichtung an einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers von einem Dritten nur für Zwecke des Arbeitgeberunternehmens oder des verbundenen Unternehmens betrieben wird. Steht die von einem Dritten dort betriebene Ladevorrichtung auch weiteren Nutzern derselben Liegenschaft, nicht aber fremden Dritten zur Verfügung, ist das ebenfalls unschädlich. Achtung: Die unengeltliche Überlassung von Strom an die Beschäftigten zum Aufladen eines privaten Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugs wird umsatzsteuerlich als steuerpflichtige Wertabgabe beurteilt. Laden von Elektrofahrrädern, Pedelecs und E-Scootern ebenfalls steuerfrei Zu den gesetzlich begünstigten Fahrzeugen, die steuerfrei aufgeladen werden könne, zählen auch Elektrofahrräder, deren Motor Geschwindigkeiten über 25 km pro Stunde unterstützt, und sogenannte Elektrokleinstfahrzeuge, insbesondere E-Scooter. Hinweis: Die Überlassung von solchen Fahrzeugen durch den Arbeitgeber ist allerdings nicht steuerfrei möglich, weil es sich um Kraftfahrzeuge handelt (vgl. § 3 Nr. 37 EStG). Anders ist dies bei den üblichen Elektrofahrrädern mit Unterstützung bis 25 km pro Stunde. Ladestrom dafür sieht die Verwaltung gar nicht erst als Arbeitslohn an, sodass sich die Frage der Steuerbefreiung erübrigt (BMF, Schreiben vom 11. November 2025, IV C 5 - S 2334/00087/014/013, Rn. 11). Ladevorrichtung für zuhause: steuerfrei oder pauschal besteuert Steuerbefreit bei der Lohnsteuer sind nach § 3 Nr. 46 EStG auch vom Arbeitgeber zusätzlich gewährte Vorteile für die zur privaten Nutzung zeitweise überlassene betriebliche Ladevorrichtung für Elektrofahrzeuge oder Hybridelektrofahrzeuge. Gemeint sind sogenannte Wallboxen zum schnellen Aufladen von Elektrofahrzeugen. Der von dieser betrieblichen Ladevorrichtung für Elektrofahrzeuge oder Hybridelektrofahrzeuge bezogene Ladestrom fällt nicht unter die Steuerbefreiung. Ladevorrichtung ist die gesamte Ladeinfrastruktur einschließlich Zubehör sowie die in diesem Zusammenhang erbrachten Dienstleistungen. Dazu gehören zum Beispiel der Aufbau, die Installation und die Inbetriebnahme der Ladevorrichtung, deren Wartung und Betrieb sowie die für die Inbetriebnahme notwendigen Vorarbeiten wie das Verlegen eines Starkstromkabels ( BMF, Schreiben vom 11. November 2025, IV C 5 - S 2334/00087/014/013, Rn. 23). Die Steuerbefreiung gilt jedoch nur bei Überlassung einer Ladevorrichtung, die im Eigentum des Arbeitgebers bleibt. Geldwerte Vorteile aus der Übereignung einer Ladevorrichtung sowie für Zuschüsse zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für den Erwerb und für die Nutzung einer Ladevorrichtung kann der Arbeitgeber pauschal mit 25 Prozent erheben (§ 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 EStG). Voraussetzung ist auch hier, dass die Leistungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. Als Bemessungsgrundlage können die Aufwendungen des Arbeitgebers für den Erwerb der Ladevorrichtung (einschließlich Umsatzsteuer) zugrunde gelegt werden ( BMF, Schreiben vom 11. November 2025, IV C 5 - S 2334/00087/014/013, Rn. 33). Sowohl die Steuerbefreiung als auch die Pauschalbesteuerungsmöglichkeit für Wallboxen gelten bis 2030. Beide führen auch zur Sozialversicherungsfreiheit. Tipp: Die steuerlichen Vergünstigungen sind an die zusätzliche Gewährung durch den Arbeitgeber geknüpft. Eine Gehaltsumwandlung zugunsten einer Wallbox ist demnach nicht möglich. Keine Aufzeichnungspflichten für steuerfreien Strom und steuerfreie Wallboxen Arbeitgeber müssen bestimmte steuerfreie Bezüge nicht im Lohnkonto aufzeichnen (§ 4 Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 LStDV). Dazu gehören auch die nach § 3 Nr. 46 EStG steuerfreien Vorteile. Steuerfreier Strom und steuerfreie Wallboxen müssen also nicht aufgezeichnet werden. Privates Aufladen des Elektrodienstwagens: Abschaffung der Monatspauschalen – Vereinfachung beim Strompreis Bei betrieblichen Elektrofahrzeugen oder Hybridelektrofahrzeugen des Arbeitgebers, die dem Arbeitnehmer auch zur privaten Nutzung überlassen werden, stellt die Erstattung der vom Arbeitnehmer selbst getragenen Stromkosten steuerfreien Auslagenersatz dar (§ 3 Nr. 50 EStG). Dazu müssen aber ab 2026 zwingend Aufzeichnungen über den Verbrauch geführt werden. Erforderlich ist ein Einzelnachweis der Kosten mit einem gesonderten stationären oder mobilen Stromzähler (beispielsweise wallbox oder fahrzeugintern). Wichtig: Die bisherigen monatlichen Pauschalen zwischen 15 und 70 Euro nach den Rn. 23 und 24 des bisherigen BMF-Schreibens vom 29. September 2020 (Höhe variiert je nachdem ob eine zusätzliche Lademöglichkeit beim Arbeitgeber besteht bzw. ein reines Elektrofahrzeug oder ein Hybridfahrzeug überlassen wird) sind letztmalig auf den laufenden Arbeitslohn anzuwenden, der für einen vor dem 1. Januar 2026 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die vor dem 1. Januar 2026 zufließen. Als Ersatz werden aber ab 2026 zur Strompreisermittlung mehrere Möglichkeiten angeboten: Maßgeblich ist in der Regel der individuelle (feste) Strompreis aus dem Vertrag des Beschäftigten mit dem Stromanbieter. Neben dem Einkaufspreis für die verbrauchte Kilowattstunde (kWh) Strom ist auch ein zu zahlender Grundpreis anteilig zu berücksichtigen. Bei einem Vertrag mit dynamischem Stromtarif bestehen keine Bedenken, die durchschnittlichen monatlichen Stromkosten je kWh einschließlich anteiligem Grundpreis zugrunde zu legen. Soweit Beschäftigte eine häusliche Ladevorrichtung nutzten, die auch durch eine private Photovoltaikanlage gespeist wird, bestehen keine Bedenken, wenn zur Ermittlung auf den vertraglichen Stromkostentarif des Stromanbieters abgestellt und dabei ein ggf. zu zahlender Grundpreis anteilig mitberücksichtigt wird. Strompreispauschale: Zur Vereinfachung gestattet die Verwaltung ab 2026 den vom Statistischen Bundesamt halbjährlich veröffentlichten Gesamtstrompreis für private Haushalte (Statistik-Code 61243-0001, Durchschnittspreise einschließlich Steuern, Abgaben und Umlagen) zugrunde zu legen. Dabei ist für das gesamte Kalenderjahr auf den für das erste Halbjahr des Vorjahres veröffentlichten Gesamtdurchschnittsstrompreis einschließlich Steuern, Abgaben und Umlagen (Wert bei einem Jahresverbrauch von 5.000 kWh bis unter 15.000 kWh) abzustellen. Dieser Gesamtdurchschnittsstrompreis ist auf volle Cent abzurunden und anschließend mit der nachgewiesenen geladenen Strommenge zu multiplizieren. Das Wahlrecht zwischen den tatsächlichen Stromkosten und der Strompreispauschale muss für das Kalenderjahr einheitlich ausgeübt werden. Durch die Strompreispauschale sind sämtliche Stromkosten aus der Nutzung einer häuslichen Ladevorrichtung abgegolten. Wichtig: Der vom Statistischen Bundesamt für das erste Halbjahr des Jahres 2025 veröffentlichte Gesamtstrompreis beträgt 34,36 Cent. Im Falle der Anwendung der Strompreispauschale für das Jahr 2026 ist damit immer ein Strompreis von 34 Cent je nachgewiesener kWh maßgeblich. Beispiel: Der Arbeitnehmer lädt seinen Dienstwagen regelmäßig zu Hause. Die für das Aufladen des Dienstwagens mittels eines gesonderten stationären oder mobilen Stromzählers nachgewiesene Strommenge für 2026 beträgt 3.000 kWh. Der Auslagenersatz für das Kalenderjahr 2026 beträgt somit höchstens 1.020 Euro (3.000 kWh * 0,34 Euro). Ergänzend ist ein zusätzlicher Auslagenersatz der anhand von Belegen nachgewiesenen tatsächlichen Kosten für den von einem Dritten (z. B. an einer öffentlichen Ladesäule) bezogenen Ladestrom zulässig. Werden die Kosten für den Ladestrom nicht vom Arbeitgeber erstattet, sondern vom betroffenen Arbeitnehmer selbst getragen, mindern die vorstehenden Beträge den geldwerten Vorteil aus der Firmenwagengestellung beim Arbeitnehmer. Auch hier sind die nachgewiesenen tatsächlichen Kosten maßgebend. Privates Elektrofahrzeug zuhause laden: Erstattung steuerpflichtig Lädt ein Arbeitnehmer sein privates Elektrofahrzeug zuhause auf, so sind keine steuerfreien Erstattungen möglich. Bei privaten Elektrofahrzeugen oder Hybridelektrofahrzeugen des Arbeitnehmers stellt die Erstattung der vom Arbeitnehmer selbst getragenen Stromkosten steuerpflichtiger Arbeitslohn dar.

Ist ein Wechsel zurück in die gesetzliche Krankenversicherung nach einem Wechsel in die private Krankenversicherung überhaupt möglich? Die Antwort lautet: Ja, aber es gibt klare Voraussetzungen. Wann genau und unter welchen Bedingungen eine Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung möglich ist. Arbeitnehmende sind krankenversicherungsfrei, wenn ihr regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt die Jahresarbeitsentgeltgrenze überschreitet (allgemeine JAEG 2025: 73.800 Euro, 2026: 77.400 Euro). Sie können sich entscheiden, ob sie ihre bisherige gesetzliche Krankenversicherung freiwillig fortsetzen oder zu einer privaten Krankenversicherung (PKV) wechseln möchten. Doch wann ist nach dem Wechsel in die PKV wieder eine Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) möglich? Zurück in die gesetzliche Krankenversicherung: Eintritt von Versicherungspflicht Hat sich ein krankenversicherungsfreier Arbeitnehmer für eine PKV entschieden, ist eine Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung nur möglich, wenn die Versicherungspflicht wieder eintritt. Dies geschieht in folgenden Fällen: Unterschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze aufgrund von Entgeltminderung Wenn das Arbeitsentgelt durch eine Reduzierung der Arbeitszeit oder andere Gründe sinkt und dadurch die Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht mehr überschritten wird, tritt die Versicherungspflicht ab dem Zeitpunkt der Entgeltminderung ein. Unterschreiten der neuen Jahresarbeitsentgeltgrenze zu Jahresbeginn Wenn das regelmäßige Jahresarbeitsentgelt des Arbeitnehmenden die zu Beginn eines neuen Kalenderjahres angehobene Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht mehr überschreitet, tritt die Versicherungspflicht ab dem 1. Januar des betreffenden Kalenderjahres ein. In diesem Fall kann die eintretende Versicherungspflicht durch einen Antrag auf Befreiung verhindert werden. Ab dem 1. Januar 2026 beträgt die allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze 77.400 Euro. Wechsel von PKV in GKV: Vorübergehende Entgeltminderung Die Versicherungsfreiheit endet grundsätzlich auch bei einer nur vorübergehenden Minderung des Arbeitsentgelts, es sei denn, die Entgeltminderung ist nur von kurzer Dauer. Für eine Entgeltminderung von nur kurzer Dauer kann nicht auf starre Zeitgrenzen zurückgegriffen werden. Sie ist in aller Regel jedoch anzunehmen, wenn die vorübergehende Minderung des Arbeitsentgelts nicht mehr als drei Monate ausmacht. Besonderheit Teilzeitbeschäftigung während Elternzeit Sinkt das Einkommen vorübergehend durch eine Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit oder eine Freistellung gemäß § 3 Pflegezeitgesetz (PflegeZG), endet die Versicherungsfreiheit. Das bedeutet, dass ein Wechsel in die GKV möglich ist. Dies gilt jedoch nicht, wenn das Einkommen aus der Teilzeitbeschäftigung trotz der Reduzierung weiterhin über der Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt. In diesem Fall bleibt die Versicherungsfreiheit bestehen und ein Wechsel in die GKV ist nicht möglich. Welche Besonderheiten in der Elternzeit zu beachten sind, lesen Sie hier. Neue Beurteilung nach der Rückkehr zum ursprünglichen Einkommen Nach der Rückkehr zu den ursprünglichen Einkommensverhältnissen ist eine erneute versicherungsrechtliche Beurteilung erforderlich. Wird die Jahresarbeitsentgeltgrenze erneut überschritten, endet die Versicherungspflicht jedoch nicht sofort, sondern frühestens mit Ablauf des Kalenderjahres. Zudem muss die Jahresarbeitsentgeltgrenze, die ab Beginn des nächsten Kalenderjahres gilt, überschritten werden. Es ist wichtig zu beachten, dass Arbeitnehmende, deren regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt die JAEG (wieder) überschreitet, krankenversicherungsfrei sind. Sie haben die Möglichkeit, Ihre bisherige Krankenversicherung als freiwillige gesetzliche Krankenversicherung fortzusetzen oder sich über ein privates Versicherungsunternehmen abzusichern. Keine Rückkehr in die GKV bei Kurzarbeit und Wiedereingliederung Ein vorübergehendes Unterschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze hat bei bestehender Versicherungsfreiheit keine Auswirkungen auf den Versicherungsstatus. Dies gilt jedoch ausschließlich in folgenden Fällen: Kurzarbeit (mit Ausnahme des Bezugs von Transferkurzarbeitergeld) Stufenweise Wiedereingliederung in das Erwerbsleben In diesen Situationen bleibt der Versicherungsstatus während der gesamten Dauer des jeweiligen Sachverhalts unverändert. Beispiel: Eine Arbeitnehmerin ist in einem Betriebsteil beschäftigt, der ab dem 1. April 2026 für sechs Monate Kurzarbeit durchführt. Sie hat 50 Prozent Arbeitsausfall, ihr Entgelt halbiert sich, sie erhält jedoch Kurzarbeitergeld. Die Arbeitnehmerin ist vor Beginn der Kurzarbeit wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei und privat versichert. Beurteilung: Bei Kurzarbeit kommt es zu einer lediglich vorübergehenden Entgeltminderung, die bei der Ermittlung des regelmäßigen Jahresarbeitsentgelts nicht berücksichtigt wird. Es ist also am 1. April 2026 keine Neuberechnung des regelmäßigen Jahresarbeitsentgelts vorzunehmen. Die Beschäftigte bleibt durchgehend krankenversicherungsfrei. Vorausschauende Berechnung des Jahresarbeitsentgelts Die für die versicherungsrechtliche Beurteilung erforderliche Ermittlung des regelmäßigen Jahresarbeitsentgelts erfolgt durch eine vorausschauende Berechnung. Diese bleibt für die Vergangenheit auch maßgebend, wenn sich zu einem späteren Zeitpunkt erneut Änderungen ergeben. Variable Arbeitsentgeltbestandteile in Form von einmalig gezahltem Arbeitsentgelt, deren Höhe an die Leistung des Arbeitnehmers geknüpft ist, bleiben dabei unberücksichtigt. Variable Arbeitsentgeltbestandteile, die individuell leistungsbezogen gewährt werden, sind allerdings dann dem regelmäßigen Jahresarbeitsentgelt zuzurechnen, wenn sie üblicherweise Bestandteil des monatlich zufließenden laufenden Arbeitsentgelts sind und dieses insoweit mitprägen. Beispiel: Der 40-jährige krankenversicherungsfreie Arbeitnehmer ist privat krankenversichert. Er vereinbart mit seinem Arbeitgeber ab dem 1. Juni 2025 eine befristete Arbeitszeitreduzierung bis zum 31. Juli 2025 (Variante 1) bzw. bis zum 30. September 2025 (Variante 2) wegen einer familiären Pflegesituation. Dadurch verringert sich das monatliche Arbeitsentgelt von 6.700 Euro auf 3.500 Euro. Beurteilung: Bei der Variante 1 handelt es sich um eine Begrenzung der Reduzierung der Bezüge auf zwei Monate. Hier ergeben sich keine Auswirkungen auf die versicherungsrechtliche Beurteilung. Der Arbeitnehmer bleibt privat krankenversichert. In der Variante 2 ist ab dem 1. Juni 2025 eine Neuberechnung des regelmäßigen Jahresarbeitsentgelts erforderlich. Da die Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht mehr überschritten wird, tritt zum 1. Juni 2025 Krankenversicherungspflicht ein. Die neuerliche Veränderung zum 1. Oktober 2025 wirkt sich nur für die Zukunft aus. Sie führt grds. zur neuerlichen Versicherungsfreiheit ab dem 1. Januar 2026. Der Arbeitnehmer muss zum 1. Januar 2026 aber nicht wieder in die PKV wechseln, sondern kann die Krankenversicherung in der GKV als freiwillige Krankenversicherung fortführen. Handelt es sich in dem Beispiel um eine Freistellung nach § 3 PflegeZG, tritt in beiden Varianten zum 1. Juni 2025 Krankenversicherungspflicht ein. Ältere Arbeitnehmende: Keine Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung möglich Ist der Arbeitnehmende zum Zeitpunkt des Eintritts der Versicherungspflicht bereits 55 Jahre alt, gelten besondere Regelungen. Eine Rückkehr in die GKV ist ausgeschlossen, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: Keine Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung in den vergangenen fünf Jahren und Mindestens in der Hälfte dieses Zeitraums war der Arbeitnehmende oder dessen Ehegatte krankenversicherungsfrei (zum Beispiel als höherverdienender Arbeitnehmender oder als Beamter) oder von der Krankenversicherungspflicht befreit (zum Beispiel nach Eintritt von Versicherungspflicht wegen Erhöhung der Jahresarbeitsentgeltgrenze) oder hauptberuflich selbstständig erwerbstätig Beispiel: Ein Arbeitnehmer, geboren am 12. März 1969, ist seit über 20 Jahren beim Arbeitgeber A beschäftigt. Seit dem 1. Januar 2015 ist er als höherverdienender Arbeitnehmer krankenversicherungsfrei und privat krankenversichert. Vom 1. April 2026 an verringert er seine wöchentliche Arbeitszeit von 40 auf 25 Stunden. Sein monatliches Arbeitsentgelt beträgt von diesem Zeitpunkt an 4.000 Euro monatlich. Beurteilung: Durch die Minderung des Arbeitsentgelts ab dem 1. April 2026 würde grundsätzlich Krankenversicherungspflicht eintreten. Zu diesem Zeitpunkt ist der Arbeitnehmer bereits 55 Jahre alt. Außerdem bestand in den vergangenen fünf Jahren zuvor (1. April 2021 bis 31. März 2026) keine Versicherung in der GKV. In dieser Zeit war der Arbeitnehmer als höherverdienender Arbeitnehmer durchgehend krankenversicherungsfrei. Da alle Kriterien für den Ausschluss der Versicherungspflicht am 1. April 2026 erfüllt sind, verbleibt der Arbeitnehmer auch nach der Entgeltreduzierung in der PKV. Rückkehr in die GKV mit einer Entgeltumwandlung Liegt das Entgelt nicht sehr weit über der JAEG, kann der Abschluss einer Betriebsrente per Entgeltumwandlung die Lösung sein. Denn damit kann sich das beitragspflichtige Entgelt vermindern. Dies hat – neben der Beitragsbemessung – gegebenenfalls auch Auswirkungen auf die versicherungsrechtliche Beurteilung der Beschäftigung. Arbeitnehmende, die in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind, haben einen Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung zugunsten einer betrieblichen Altersversorgung (bAV). Um eine Entgeltumwandlung handelt es sich, wenn vereinbarte künftige Entgelte für den Aufbau von Anwartschaften auf eine betriebliche Altersversorgung wertgleich umgewandelt werden. Diese Zuwendungen sind beitragsfrei bis zu einem Betrag von vier Prozent der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze (BBG) der Rentenversicherung. Das entspricht 2026 einem Jahresbetrag von 4.056 Euro (338 Euro monatlich). Versicherungsfreiheit endet sofort Beträgt das Jahresarbeitsentgelt eines Arbeitnehmenden 2026 bis zu 81.456 Euro, so führt die Nutzung des vollen beitragsfreien Betrages von 4.056 Euro jährlich zu einem Jahresarbeitsentgelt in Höhe von höchstens 77.400 Euro. Damit wird die JAEG (2026 = 77.400 Euro) nicht mehr überschritten und der Arbeitnehmende wird wieder krankenversicherungspflichtig. Wird die JAEG im Laufe eines Kalenderjahres nicht nur vorübergehend unterschritten, endet die Versicherungsfreiheit unmittelbar und nicht erst zum Ende des Kalenderjahres. Das Rechenexempel funktioniert entsprechend auf abgesenktem Niveau für Arbeitnehmende, bei denen die "besondere JAEG" anzuwenden ist. Diese beträgt 69.750 Euro im Jahr 2026. Zusatznutzen für Arbeitgeber Die Entgeltumwandlung zugunsten einer bAV kann, wenn das Jahresentgelt nicht zu hoch ist, eine Rückkehr in die GKV ermöglichen – und das, ohne dass auf Entgeltansprüche tatsächlich verzichtet werden muss. Darüber hinaus hat die bAV sowohl für Arbeitnehmende als auch für Arbeitgeber den zusätzlichen Anreiz der Ersparnis von Steuer- und Sozialabgaben.

Zum 17. Mal ehrt der Corporate Health Award Unternehmen, die Gesundheit zur Strategie machen. Die Auszeichnung zeigt: Nachhaltiges Gesundheitsmanagement ist mehr als ein Wettbewerbsvorteil – es ist ein Beitrag zur sozialen Verantwortung und ein Schlüssel für langfristigen Erfolg. Seit 17 Jahren werden Unternehmen und Institutionen in Deutschland für ihr herausragendes Gesundheitsmanagement mit dem Corporate Health Award ausgezeichnet. Die prämierten Unternehmen setzen ein starkes Zeichen: Sie investieren aktiv in die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden und zeigen, dass ein effektives Gesundheitsmanagement nicht nur ein Wettbewerbsvorteil ist, sondern auch einen nachhaltigen Beitrag zur Gesellschaft leistet. Initiator des Preises ist das Marktforschungs- und Zertifizierungsinstitut EUPD Research. Grundlage für die Bewertung der an der Preisvergabe teilnehmenden Unternehmen bildet der wissenschaftlich fundierte Corporate Health Evaluation Standard (CHES). Die finale Auswahl der Preisträger erfolgt durch einen unabhängigen Expertenbeirat. Mit der feierlichen Verleihung des diesjährigen Corporate Health Awards Anfang Dezember auf dem Petersberg bei Bonn würdigte EUPD Research gemeinsam mit dem Handelsblatt 30 Unternehmen und Institutionen, die durch nachhaltiges Handeln und innovative Gesundheitsstrategien wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer Verantwortung verbinden. Psychische Gesundheit im Fokus des Corporate Health Awards 2025 Bei den Preisträgern zeigt sich ein klarer Trend im Bereich Mental Health: Unternehmen setzen verstärkt auf Maßnahmen zur psychischen Gesundheit. Laut EUPD Research fließen inzwischen 27 Prozent des gesamten BGM-Budgets in diesen Bereich – mehr als in die Prävention von Sucht, Ernährung oder Ergonomie zusammen. Psychische Gesundheit zeigt sich so als zentrales Handlungsfeld, in dem Unternehmen ihre Verantwortung für die Mitarbeitenden wahrnehmen und gleichzeitig präventiv gegen Belastungen und Stress vorgehen. Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung im Gesundheitsmanagement Neben dem starken Fokus auf psychische Gesundheit zeigt sich eine weitere Entwicklung gegenüber den bisherigen Preisverleihungen. Unternehmen verankern ihr betriebliches Gesundheitsmanagement zunehmend in langfristigen und nachhaltigen Strategien. Besonders Großunternehmen integrieren ihr BGM in ihre Nachhaltigkeitsstrategie (ESG), um nicht nur die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden zu fördern, sondern auch soziale Verantwortung sichtbar zu machen. "Das Bedürfnis von Firmen, durch ihr BGM öffentlich sichtbarer zu werden, ist merklich gewachsen", erklärt Steffen Klink, COO der EUPD Group. Bedeutung des betrieblichen Gesundheitsmanagements Ein effektives betriebliches Gesundheitsmanagement verbindet soziale Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Unternehmen, die Gesundheit fest in ihrer Strategie verankern, schaffen nicht nur eine zukunftsfähige Unternehmenskultur, sondern legen den Grundstein für langfristigen Erfolg. "Wer Mitarbeitende gezielt stärkt und verantwortungsbewusst handelt, prägt eine zukunftsfähige Unternehmenskultur", betont Joshua Baaken, Director Social & ESG Operations bei EUPD Research. Er sieht die Preisträger des Corporate Health Awards als Vorbilder für innovative Ansätze und kontinuierliche Weiterentwicklung im Gesundheitsmanagement, die Teams und Organisationen nachhaltig voranbringen. Corporate Health Award 2025: die ausgezeichneten Unternehmen Die ausgezeichneten Unternehmen des Corporate Health Awards 2025 (in alphabetischer Reihenfolge): Kategorie Großkonzerne AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG Berliner Wasserbetriebe AöR Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG Deutsche Telekom AG EWE AG Flughafen München GmbH Gleiss Lutz JT International Germany GmbH Krones AG Lidl in Deutschland LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein a.G. Rheinmetall AG Schaeffler Nürnberg Kategorie Hochschule Universität Bielefeld Universität Stuttgart Kategorie Mittelstand und öffentliche Verwaltung Bayerischer Landtag Landtagsamt BKK24 GLS Gemeinschaftsbank eG Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) NEW AG Raith Architekten Gmbh Silver Atena GmbH Sonderpreise CGI Deutschland B.V. & Co. KG - Sonderpreis Leadership Deutsche Bank AG - Sonderpreis Family & Work Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft - Sonderpreis Innovation DHL Group - Sonderpreis Ergonomics Handwerkskammer Dortmund - Sonderpreis Gesundes Handwerk KfW – Sonderpreis Mental Health Kreissparkasse Köln - Sonderpreis Addiction Prevention Mainova AG - Sonderpreis Corporate Fitness Viega GmbH & Co. KG - Sonderpreis Cancer Prevention W&W-Gruppe - Sonderpreis Demografic Management

Fahrtzeiten, die Arbeitnehmende von einem festgelegten Treffpunkt zu ihrem Einsatzort und zurück unternehmen, sind als Arbeitszeit im Sinne der Arbeitszeitrichtlinie zu werten. Das hat der EuGH im Fall spanischer Arbeitnehmer festgestellt. Die europäische Arbeitsrichtlinie definiert Arbeitszeit als jede Zeitspanne, während der ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten arbeitet, dem Arbeitgeber zur Verfügung steht und seine Tätigkeit ausübt oder Aufgaben wahrnimmt. Dagegen ist Ruhezeit jede Zeitspanne außerhalb der Arbeitszeit. Es gibt nur entweder, oder, aber nichts dazwischen. Ob die Zeit, die Arbeitnehmende zu Beginn und am Ende eines Arbeitstags für die Fahrt mit einem Fahrzeug des Unternehmens vom Treffpunkt zur Arbeitsstelle, an der sie ihre Aufgaben wahrnehmen, und zurück zum Treffpunkt aufwenden, als "Arbeitszeit" im Sinne der Richtlinie anzusehen ist, hatte vorliegend der Europäische Gerichtshof (EuGH) zu beurteilen. Der Fall: Unternehmen wertet nur Hinfahrten als Arbeitszeit Die Arbeitnehmenden des spanischen Unternehmens Vaersa haben keinen festen Arbeitsort. Sie arbeiten in Naturräumen und Mikronaturschutzgebieten in der Region Valencia. Statt direkt von ihrem Wohnsitz zur Arbeitsstelle zu fahren, müssen sie sich zu einer festgelegten Uhrzeit an einem Abfahrtsort ("Stützpunkt") einfinden. Von dort fahren sie gemeinsam in einem Fahrzeug des Arbeitgebers, das von einem Mitarbeiter gesteuert wird und das nötige Material transportiert. Nach der Arbeit werden sie zurück zum Stützpunkt gebracht und fahren von dort eigenständig nach Hause. Die genaue Arbeitsstelle wird monatlich mitgeteilt. Während dieser Fahrten können die Arbeitnehmer keine Aufgaben erledigen und haben aber keine freie Verfügung über ihre Zeit, da der Arbeitgeber Transportmittel, Zeit und Ablauf vorgibt. Laut Arbeitsvertrag zählt die Fahrzeit zwischen Treffpunkt und Arbeitsstelle nicht als Arbeitszeit, wurde aber in der Praxis durch den Arbeitgeber für die Hinfahrt erfasst, nicht jedoch für die Rückfahrt. Daher kam es zum Rechtsstreit. Das spanische Arbeitsgericht legte den Fall dem EuGH vor. EuGH: Fahrten sind als Arbeitszeit einzustufen Der EuGH hat entschieden, dass die Fahrten von Arbeitnehmern von einem vom Arbeitgeber festgelegten Treffpunkt zu einem Arbeitsort, als Arbeitszeit gelten. Dies gilt insbesondere, wenn die Fahrten zu festgelegten Zeiten und in einem Fahrzeug des Arbeitgebers erfolgen. Der EuGH überprüfte dabei die drei wesentlichen Merkmale des Begriffs Arbeitszeit im Sinne der Richtlinie und kam zum Ergebnis, dass alle Voraussetzungen vorliegend erfüllt seien. Der Gerichtshof stellte in seiner Begründung fest, dass die Modalitäten der Hin- und Rückfahrt der betroffenen Arbeitnehmer im Bereich Biodiversität vorliegend von ihrem Arbeitgeber vorgegeben werden, der u. a. das für diese Fahrten verwendete Transportmittel, den Abfahrtsort bzw. Ankunftsort bei der Rückfahrt, die Abfahrtszeit und das Ziel, nämlich eine Arbeitsstelle, bestimmt. Einen gewöhnlichen Arbeitsort gebe es demnach nicht. Die Situation sei folglich vergleichbar mit der von Arbeitnehmern, die Fahrten zwischen ihrem Wohnsitz und den Standorten ihrer Kunden unternehmen, um dort technische Leistungen zu erbringen. Der EuGH verwies darauf, dass er hier schon früher entschieden hat, dass solche Fahrten ein notwendiges Mittel sind und Arbeitnehmer währenddessen ihre Tätigkeit ausüben oder Aufgaben wahrnehmen. Demnach sei davon auszugehen, dass die betroffenen Arbeitnehmer während ihrer Fahrten vom Stützpunkt zur betreffenden Arbeitsstelle und zurück keinen festen Arbeitsort haben und ihre Tätigkeit ausüben oder ihre Aufgaben wahrnehmen. Fahrten gehören zur Arbeit von Arbeitnehmenden ohne festen Arbeitsort Auch die Verfügbarkeit für den Arbeitgeber war aufgrund der Umstände nach Auffassung des EuGH gegeben: Die betroffenen Arbeitnehmer hätten während der erforderlichen Fahrzeiten in die Naturschutzgebiete und zurück nicht die Möglichkeit, frei über ihre Zeit zu verfügen und ihren eigenen Interessen nachzugehen. Schon in früheren Urteilen hatte der EuGH darauf abgestellt, dass Arbeitnehmer, die keinen festen Arbeitsort haben und für deren Arbeit ständig Fahrten anfallen, davon auszugehen ist, dass sie während dieser Fahrt arbeiten. Denn die Fahrten gehörten untrennbar zum Wesen eines Arbeitnehmers, der keinen festen oder gewöhnlichen Arbeitsort hat, sodass der Arbeitsort solcher Beschäftigten nicht auf die Orte beschränkt werden kann, an denen sie physisch tätig werden. Dies war auch vorliegend gegeben, wodurch alle wesentlichen Merkmale des Begriffs "Arbeitszeit" im Sinne der Richtlinie erfüllt seien. Hinweis: EuGH, Urteil vom 9. Oktober 2025 in der Rechtssache C‑110/24




