ENTWICKELN | VERÄNDERN
MANAGEN | ZUKUNFT GESTALTEN
Das Management, dass Sie jetzt gerade brauchen
- Business Consulting
- Business Personal-Recruiting
- Business Fitness
- Business Coaching
- Immobilien
Beratungs- & Managementagentur
THL-Consulting
Optimal betreut - Problem gelöst!
Suchen Sie ein Management, das die ideale Ausgangsbasis bietet, um Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter zukunftssicher zu machen? Benötigen Sie eine Unternehmensberatung, Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung, qualifiziertes Fachpersonal oder Coaches für die Weiterbildung? Dann sind Sie bei der Beratungs- und Managementagentur THL-Consulting genau richtig!
Teilen Sie uns Ihr Anliegen mit, und wir präsentieren Ihnen maßgeschneiderte Lösungen. Wir planen, managen, coachen, vermitteln und führen gezielte Recruiting-Strategien durch. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten unterstützen und gönnen Sie sich eine stressfreie und erholsame Auszeit vom hektischen Alltag.
Für Sie
Aus EINER Hand
Management
Wir treten als Berater und Coaches in Erscheinung, entwickeln herausragende Strategien für Chancenmanagement und Markenpositionierung und nutzen unser Netzwerk, um die erforderlichen Maßnahmen erfolgreich umzusetzen.
Weiterbildung / Coaching
Wir rekrutieren die Crème de la Crème an Spezialisten aus unserem Netzwerk – Coaches, Dozenten und weitere Fachkräfte – um Ihnen und Ihren Teams gezielt einen umfassenden Know-how-Boost zu bieten. Darüber hinaus finden Sie auf unserer Buchungsplattform eine Auswahl an erfolgreichen Coachingprogrammen..
Vermarktung
Wir verleihen Ihren Produkten mit unserer Marketingmagie einen besonderen Glanz! Durch unser weitreichendes Netzwerk wählen wir die effektivsten Strategien und Talente aus, um crossmediale Kampagnen mit fesselnden Geschichten über alle Kanäle hinweg zu kreieren. Als besonderes Highlight planen wir zudem Veranstaltungen, die begeistern und in Erinnerung bleiben!
Betriebliches Gesundheitsmanagement
Wir schnappen uns die Top-Spezialisten aus unserem Netzwerk für Ihr betriebliches Gesundheitsmanagement und zaubern maßgeschneiderte Gesundheitsmaßnahmen in Ihr Unternehmen. Unsere Kurse? Die finden Sie blitzschnell auf unserem Buchungsportal!
Produktion
Wir fungieren als Ihr Executive Producer und gestalten die Außendarstellung Ihres Unternehmens. In enger Zusammenarbeit mit Ihnen setzen wir hochwertige Filmproduktionen, Onlineauftritte und Werbeanzeigen um.
Personal Recruiting
Durch ein spezialisiertes Personalrecruiting identifizieren wir Talente aus unserem Netzwerk sowie aus Bewerbungsverfahren und vermitteln Ihnen qualifiziertes Personal für Ihre offenen Stellen. Zudem übernehmen wir die Durchführung der Bewerbungsgespräche mit den potenziellen Kandidaten.
Vermittlung von Spezialisten
Wir liefern Top-Expertise auf Zeit, wenn es notwendig ist
Umsatz im Sturzflug, Mitarbeiter im Ausfallmodus oder fehlende Skills im Unternehmen? Willkommen im Land der operativen Risiken! Projekte auf Eis, Teams ohne Kapitän, und die Uhr tickt gnadenlos. Monatelanges Recruiting oder Stillstand? Nein danke! Was Sie jetzt brauchen, sind fähige Spezialisten, die die Lage checken und sofort loslegen.
THL-Consulting hat genau diese Einsätze auf dem Radar. Mit technischer Finesse und einem pfiffigen Recruiting-Zauber holen wir blitzschnell den passenden Profi aus unserem Expertentool.
Wir lösen Ihr Problem punktgenau, damit Sie wieder das Steuer übernehmen und mit einem Lächeln in die Zukunft steuern können.
Wer wir sind
dynamisch und flexibel
THL-Consulting ist die dynamische Beratungs- und Managementagentur aus Nordrhein-Westfalen, die sowohl digital als auch analog rockt!
Wir sind nicht nur die Profis im Klienten-Matching, sondern auch die Meister der gezielten Beratung. Mit unseren Partnern zaubern wir Managementstrategien, Mitarbeitercoachings und Marketing-Hits für Unternehmen und haben auch ein Auge auf Immobilien.
Wir sind der Brückenbauer zwischen Wirtschaftsunternehmen und den Klienten, die wir repräsentieren!
Was uns ausmacht
nahbar und authentisch
Wir wirbeln die Vermittlungsbranche ordentlich durcheinander! Als Agentur jonglieren wir mit Bravour auf Augenhöhe, sowohl mit unseren Kunden als auch Klienten. Wir sind der freundliche Ansprechpartner um die Ecke und der direkte Draht für beide Seiten. Das sorgt für Vertrauen und ein prima Geschäftsklima.
Unsere geheime Zutat? Alle glücklich machen – Kunden, Klienten und Kooperationspartner.
Wir wollen nicht nur Kundenwünsche erfüllen, sondern auch dafür sorgen, dass unsere Klienten mit Herzblut ihre Produkte und Dienstleistungen vertreten. Denn nur glückliche Klienten sind die echten Überzeugungskünstler und kommen auch in Zukunft gerne wieder zum Einsatz!
Wie wir denken
unkonventionell und glasklar
Wir denken quer! Die Beratungs- & Managementagentur THL-Consulting wurde ins Leben gerufen, um Buchungsprozesse und Projektdurchführungen einfacher, durchsichtiger und vor allem gesprächiger zu machen. Und das für alle Beteiligten!
Unsere Klienten haben den gleichen VIP-Faktor wie unsere Kunden: Wir setzen auf Klarheit, Menschlichkeit und Zuverlässigkeit. Raus aus den verstaubten Beratungs- und Marketingbunkern, weg von der unpersönlichen Beratung – und rein mit echten, lebendigen Menschen voller Charakter!
Services
Coaching
Casting
Producing
Jede Menge messbaren Mehrwert
Die Beratungs- & Managementagentur THL-Consulting in Zahlen
40+
Jahre an Berufserfahrung
80+
Kooperationspartner, Experten, Fachkräfte
96%
Kundenzufriedenheit
91%
Erfolgsquote im Durchschnitt aller Leistungsfelder
Was unsere Klienten und Kunden über uns sagen!
CONNECT
Was können wir für Sie tun?
Sprechen Sie mit uns – ganz ohne Verpflichtungen!
Erzählen Sie uns von Ihrem Anliegen, Ihrem Projekt oder Ihrem Problem. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Zusammenarbeit
Optimal am Start, Problem verbannt!
Wollen Sie von uns betreut werden?
Bewerben Sie sich jetzt und werden Sie unser VIP-Klient!
A K T U E L L


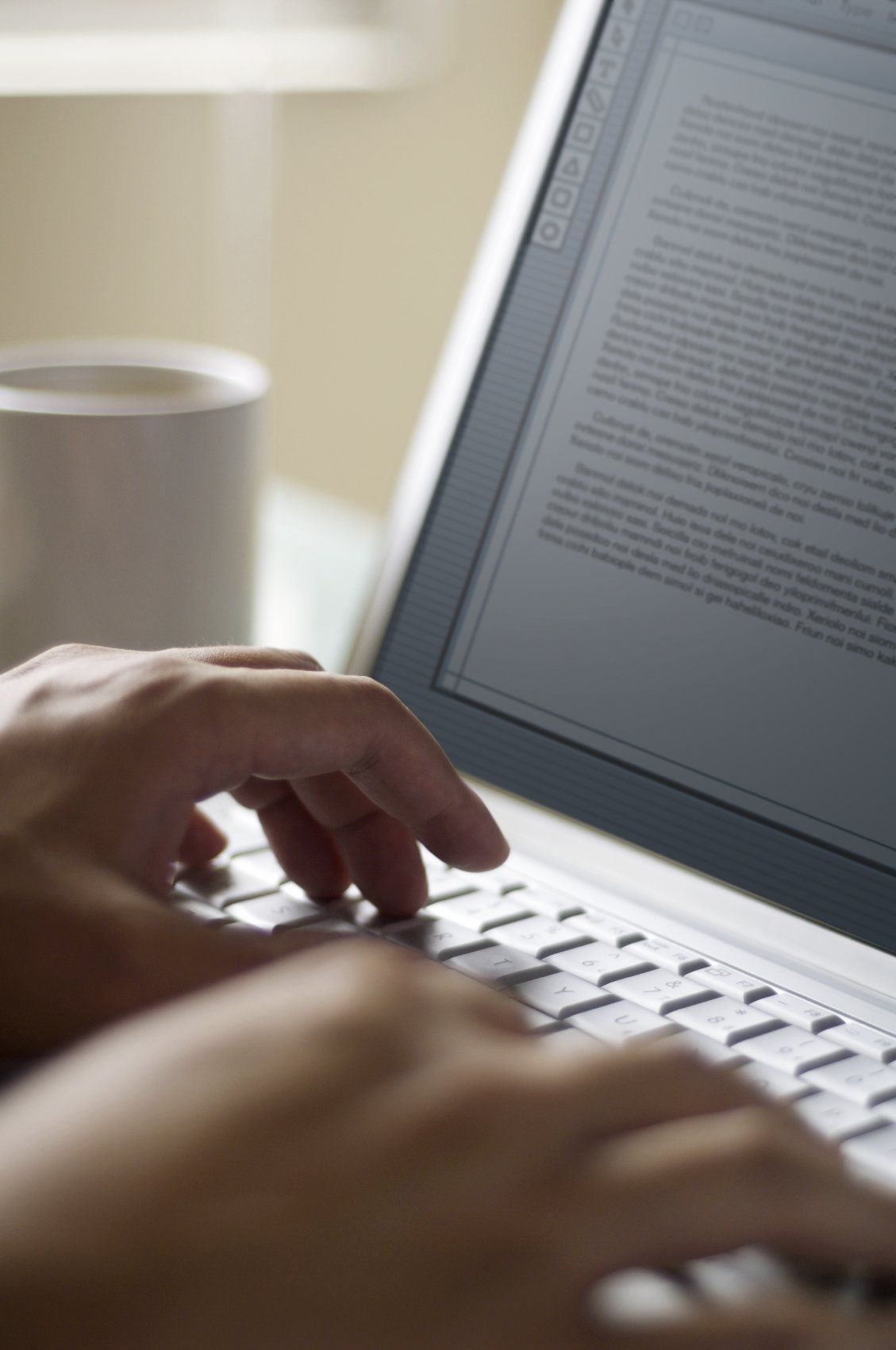
IN KONTAKT BLEIBEN
Registrieren Sie sich und bleiben Sie stets kostenlos über Neuigkeiten informiert.






